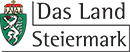"Kommunikative Räume und die Offenheit der Zukunft"
Intensiv, herausfordernd und zielorientiert: Ein Blick in die Arbeit der Fokusgruppen
Die Themen und Orte
Die Sitzungen in den fünf Fokusgruppen wurden erfolgreich abgeschlossen. Nach fünf konstituierenden Sitzungen in der steirischen Landesbibliothek in Graz, führten die unterschiedlichen Gruppen je fünf spezifische Themensitzungen (Gesellschaft / Publikum; Zusammenleben / Zusammenarbeiten; Jugend / Bildung; Infrastruktur: Kreation und Produktion; Abschließende zusammenführende Sitzung) an 25 verschiedenen Orte in allen sieben Großregionen der gesamten Steiermark durch.
Unterwegs waren die Fokusgruppen mit einem gemeinsamen Kleinbus oder mit der öffentlichen Bahn und nur wenn zeitlich oder geografisch notwendig, mit individuellen PKWs. Damit wurden bereits grundlegende Themen wie Mobilität, Klimawandel wie auch die Unterschiedlichkeit und Individualität der Regionen bewusst in den Blick genommen.
"Herzlicher Dank gebührt der großen Gastfreundschaft an den vielen wunderbaren Orten, die besucht wurden!" ist sich das Projektkernteam unisono einig. Die jeweiligen Gastgeberinnen und Gastgeber waren auch immer eingeladen, vor Ort über den Ort, über Tätigkeiten und regionale Programme zu berichten, und den weiteren Verlauf der Kulturstrategie 2030 zu verfolgen und in ihr Umfeld zu tragen.
Heimatsaal, Volkskundemuseum; Steiermärkische Landesbibliothek - Graz / Kunsthaus Weiz / Prennings Garten Übelbach / Gemeinde Gnas / Leoben, Kulturquartier / Knittelfeld Rathaus/Gemeinde / Musikschule Schladming / Veranstaltungszentrum Ramsau - Liezen / Stadtmuseum Eisenerz / Stieglerhaus St. Stefan ob Stainz / Kunsthaus Mürz / Kürbis Wies / Kaindorf (LEADER Oststeirisches Kernland) / Musikerheim der Feuerwehrmusik Eisbach/Rein - Judendorf Straßengel / Galerie Marenzi - Leibnitz / Pavelhaus - Laafeld-Bad Radkersburg / Feuerwehrmuseum Groß St. Florian / Feldbach / FH Bad Gleichenberg / Rathaus Voitsberg / Gleisdorf VA der Gemeinde / Griessner Stadl - Stadl an der Mur / Schloss Trautenfels - Liezen / Gemeinde Grundlsee / Kulturreferat - Bruck an der Mur
Die Ziele
- Es geht um die Erarbeitung konkreter Umsetzungsempfehlungen für die Politik.
- Es geht um Freude und Begeisterung an Kunst und Kultur durch bessere Sichtbar- und Zugänglichkeit zu verstärken.
- Es geht um ihre tiefgehende Bedeutung für Wirtschafts- und Bildungsstandorte zu erkennen.
- Es geht um das Potential für Wohlbefinden und Gesundheit auszubauen, das Kunst und Kultur positiv zu beeinflussen in der Lage ist.
- Es geht um die breite öffentliche Sensibilisierung für Kunst und Kultur in ihren unterschiedlichen Bereichen: "Hochkultur", "Volkskultur", "Freie Szene" und ihren regionalen Stärken.
- Es geht um die Schnittmengen und deren großer Bedeutung für eine offene, friedliche, vielfältige Gesellschaft des Respekts und der gegenseitigen Fürsorge.
- Es geht um die Verbesserung der Rahmenbedingungen für gelingende Kooperationen.
- Es geht um ideelle und strukturelle Wertschätzung für Ehrenamt.
- Es geht um die Erhöhung der monetären Ausstattung, nicht zuletzt im bundesweiten Fair-Pay-Prozess.
Die Arbeit in den fünf Fokusgruppen
Je acht Akteurinnen und Akteure unterschiedlicher künstlerischer und/oder kultureller Praxis trafen unter der moderierenden Leitung einer erfahrenen Referentin aus der A9 zu den Themensitzungen zusammen. Alle acht Mitglieder wurden so ausgewählt, dass sie für spezifische Zugänge stehen, in ein breites Umfeld Kontakt halten und mit vielen weiteren Kunst- und Kulturakteurinnen uns -akteuren im Austausch bleiben:
Fokusgruppen-Referentinnen
- Förderungskultur (inklusive Fair Pay): Evelyn Kometter
- Regionale Profile und Kooperationen zwischen Initiativen und Institutionen: Christiane Kada
- Kulturdrehscheiben in den Regionen: Gerlinde Schiestl-Reif
- Bereichs- und ressortübergreifendes Arbeiten: Katharina Kocher-Lichem
- Zukunftswerkstätten: Petra Sieder-Grabner
Die beiden unabhängigen Beratenden - Heidrun Primas und Werner Schrempf - die gemeinsam mit dem Projektkernteam die Vorgangsweise konzipiert haben, begleiten alle Sitzungen, modifizieren bei Bedarf mit allen Beteiligten einzelne Bausteine im Ablauf und stellen inhaltliche Querverbindungen zwischen den unterschiedlichen Fokusgruppen und zum grundlegenden Anliegenkatalog der 600 Mitdiskutierenden der Regionalkonferenzen her.
Sie arbeiten begleitend an einem Living Paper, das ständig wächst, die Essenzen der einzelnen Sitzungen sammelt, zusammenfasst und abschließend mit den Fokusgruppen finalisiert. Alles verbindend steht eine digitale Pinnwand ("Padlet") zur Verfügung, auf die alle Mitglieder der Fokusgruppen Zugriff haben.
Sie dient sowohl zum inhaltlichen Austausch als auch als Inspirationsquelle durch die ständig wachsende Sammlung von Best-Practice-Beispielen aus den lebendigen Archiven aller Beteiligter. Dieses digitale Werkzeug könnte nach der modellhaften Erprobung als Austauschformat in die Kommunikation zwischen Verwaltungsebene und Kunst- und Kulturlandschaft aufgenommen werden.
Zuständig für die operative Koordination sowie die komplexe Organisation dieser Implementierungsphase ist das Projektleitungsteam, Sandra Kocuvan und Gerlinde Schiestl-Reif, die auch bei allen Fokusgruppensitzungen in den Regionen basal unterstützend dabei sind.
Die umfassende Vernetzung und Synergienutzung liegt in den Händen des gesamten Projektkernteams, unter der orchestrierenden Gesamtleitung von Abteilungsleiter Patrick Schnabl.
Noch etwas:
Zu jeder Themensitzung wurden je zwei externe Expertinnen bzw. Experten - regional, überregional und international - eingeladen, um den Themenschwerpunkt aus ihrer jeweiligen Perspektive mit kurzen impulsgebenden Beiträgen inspiriend zu beleuchten. Auch sie sind eingeladen, in ihrem Umfeld über den Strategieprozess zu berichten und im Austausch zu bleiben.
Somit entsteht ein vielschichtiges inhaltliches Wissensgewebe aus unterschiedlichen Bereichen.
Ein spezieller Raum für die Jugend:
Junge Kunstakteurinnen bzw. Kunstakteure aus der Ortweinschule kommen zu den Diskussionen, nicht nur um dabei zu sein und zuzuhören. Sie sollen ihre jungendliche Sicht für notwendige Zukunftsthemen einbringen.
Es ging ans Eingemachte!
Den Kern der fünfstündigen Themensitzungen bildete die Erarbeitung konkreter Umsetzungsempfehlungen für die Politik. Die Basis dafür sind die bereits erarbeiteten Handlungsfelder und Anliegenkataloge, deren Implementierung mit dem Landtagsbeschluss vom Juni 2023 auf den Weg gebracht wurden.
Alle Anliegen wurden konzise in Fragen umgewandelt, die zuerst in Zweiergruppen und dann im Plenum der Fokusgruppe vertiefend diskutiert und erörtert wurden. Aus den weitläufigen Anliegen wurden konkrete Umsetzungsvorschläge abgeleitet, ohne den Fokus auf das reichhaltige Wissen des breiten Feldes der Beteiligung bis hierher zu verlieren.
Zu jeder Themensitzung wurden Sprecherinnen bzw. Sprecher ernannt, deren Aufgabe es ist, die zentralen Erkenntnisse in einem Essenzpapier zu erfassen. Diese Essenzpapiere bildeten die Grundlage jenes zusammenfassenden Papiers, das der Steiermärkischen Landesregierung und in weiterer Folge dem Landtag Steiermark zur Beschlussfassung vorgelegt wurde.
Kollaborativer Weg: "Alle sollen sich angesprochen fühlen, mitzugestalten."
Ein Grundanliegen war es, einen zentralen Leitsatz des bisherigen Prozesses: „Zusammenarbeit statt Konkurrenz", in die Alltagspraxis zu übersetzen und den Punkten des Fairnesskodex des Bundes, sowie der UNESCO-Agenda für kulturelle Vielfalt zu folgen, die eine wohlwollende, respektvolle und transparente Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen vielen verschiedenen Positionen eines vielfältigen WIR beschreiben: Zwischen den unterschiedlichen Bereichen aus Kunst und Kultur, „Volkskultur", „Freie Szene", „Hochkultur", den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit, Kunst- und Kulturproduktion, den unterschiedlichen Bereichen wie Beteiligungen des Landes und gemeinnützigen Vereinen im Bereich der „Volkskultur", wie der „freien Szene", hin zu Gremien wie dem Kulturkuratorium und den Fachjurys, wie zu überregionalen und internationalen Gremien.
Konstruktive Kritik - Bleiben Sie uns gewogen!
Wir wünschen uns weiterhin konstruktive Kritik: Sie zu formulieren ist nicht einfacher, als sie anzunehmen und umzusetzen. Manche Beziehungen/Verhältnisse gehören geklärt, manche ausdiskutiert und verfeinert, andere aufgelöst.
All das braucht Mut und geht nur gemeinsam. Manchmal verlässt die eine/den einen die Kraft und die Zuversicht, dann springt die/der andere ein und hält die Spannung ...
In diesem Sinne sind wir mitten in einer neuen Kulturpraxis des Gemeinsamen.
Sie ermöglicht friedliches Zusammenleben und Weiterentwicklung unserer demokratischen Werte und Gesellschaft.